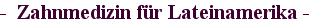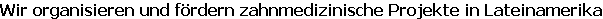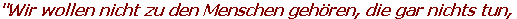Hosbach, Judith
Erfahrungsberichte > Archiv
Bolivien hautnah, 8.3.-7.4.2019
Zunächst sah es so aus als fiele die Reise ins Wasser. Alle Vorbereitungen und Vorfreude dahin. Der begleitende Zahnarzt hatte kurzfristig abgesagt und es war unmöglich, noch einen Ersatz zu finden. Da wir noch nicht approbiert sind, ist es uns nicht gestattet, ohne Zahnarzt mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung zu arbeiten. Ernüchtert und enttäuscht verabschiedete ich mich innerlich von dem geplanten Abenteuer und kalkulierte grob die finanziellen Verluste. Nur noch einen Klick von der Stornierung entfernt, segelte die Lösung ins Postfach: Der Projektleiter Ekkehard Schlichtenhorst bot uns an, die erste Woche mit ihm in Boliviens Hauptstadt Sucre zu arbeiten. Die folgenden Wochen würden wir unsere Behandlungs-Ausflüge ins Umland aus dem kleinen Ort Padilla unternehmen, gemeinsam mit den dort ansässigen Zahnärzten. Was für ein Glück! Im Rückblick war es sogar das Beste was uns passieren konnte, denn wir hatten eine wunderbare abwechslungsreiche Zeit.
Lima
Am 27. Februar ging es in aller Frühe in Frankfurt los. 11 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken sollte für die kommenden sechs Wochen reichen. Mit einberechnet waren sämtliche zahnärztliche Materialien, die dort nicht erhältlich sind und welche die Voluntarios sich selbst mitbringen. Unser Zielflughafen war Lima. Wir wollten vorab eine Woche Perú erkunden.
Nach insgesamt 25 Stunden Reisezeit erreichten wir um 19 Uhr Ortszeit den Flughafen Jorge Chávez. Als wir ins Freie traten, umhüllte uns sofort ein stickiges Gemisch aus feucht-warmer Luft und Abgasen. Nach einer unsäglichen Taxifahrt bogen wir schließlich in das malerische Viertel Barranco ab, wo uns Luisa, unsere Gastgeberin, die Tür öffnete und die kommenden zwei Tage liebevoll umsorgte.
Wie in jeder großen Stadt ist es schwer, sich ein vollständiges Bild von ihr zu machen. Lima jedenfalls entzieht sich jeder einheitlichen Beschreibung. Hässlich, abweisend, elegant und zauberhaft – alles trifft gleichermaßen zu. An der Pazifikküste fließt der Verkehr so beständig und unaufhaltsam wie die Wellen am schmutzigen Kiesstrand brechen. Hochhäuser ragen in den dunstig blauen Himmel, von dem die Sonne erbarmungslos auf die Wüstenmetropole niederbrennt. Hier sollte ich während meines sechswöchigen Aufenthaltes das beste Essen genießen: Ceviche, eine Art peruanisches Sushi, mit Pisco Sour, was einem Whiskey Sour nahekommt – ein köstliches Erlebnis, das mich sanft betrunken machte.
Nach insgesamt 25 Stunden Reisezeit erreichten wir um 19 Uhr Ortszeit den Flughafen Jorge Chávez. Als wir ins Freie traten, umhüllte uns sofort ein stickiges Gemisch aus feucht-warmer Luft und Abgasen. Nach einer unsäglichen Taxifahrt bogen wir schließlich in das malerische Viertel Barranco ab, wo uns Luisa, unsere Gastgeberin, die Tür öffnete und die kommenden zwei Tage liebevoll umsorgte.
Wie in jeder großen Stadt ist es schwer, sich ein vollständiges Bild von ihr zu machen. Lima jedenfalls entzieht sich jeder einheitlichen Beschreibung. Hässlich, abweisend, elegant und zauberhaft – alles trifft gleichermaßen zu. An der Pazifikküste fließt der Verkehr so beständig und unaufhaltsam wie die Wellen am schmutzigen Kiesstrand brechen. Hochhäuser ragen in den dunstig blauen Himmel, von dem die Sonne erbarmungslos auf die Wüstenmetropole niederbrennt. Hier sollte ich während meines sechswöchigen Aufenthaltes das beste Essen genießen: Ceviche, eine Art peruanisches Sushi, mit Pisco Sour, was einem Whiskey Sour nahekommt – ein köstliches Erlebnis, das mich sanft betrunken machte.
Cusco
Unsere nächste Station war Cusco, wo wir zwischen grünen Hügelketten auf 3.460 m Höhe hausten. Nicanor, unser Hausherr, hatte uns das Zimmer gezeigt und einen Mate de Coca-Tee gebracht. Wir sollten uns ausruhen und aus der Schale die losen Coca-Blätter kauen. Leicht fröstelnd und müde trinken wir den Tee und blicken auf die Stadt, die auf alten Inka-Mauern fußt. Wir kauften weiche Alpaka-Ponchos und wärmten uns immer wieder am Coca-Tee, der wirklich gut tat und etwas muffig schmeckte. Aus Zeitmangel und Ablehnung von Massentourismus ließen wir Machu Picchu ausfallen und starteten stattdessen von Cusco aus nach Puerto Maldonado. Wir hatten uns für ein Dschungel-Erlebnis am Seitenarm des Amazonas entschieden. Das Klima erinnerte an das Schlangenhaus im Frankfurter Zoo und machte mir etwas zu schaffen. Zwischen den Exkursionen, bei denen wir Kapuzineräffchen sahen und Piranhas angelten, lag ich faul in der Hängematte, genoss exotische Fruchtsäfte und blickte auf den Río Tambopata.
Unser Perú-Aufenthalt endete mit einer abenteuerlichen Nachtfahrt Richtung La Paz. Kurz vor der eigentlichen Abfahrt stellte sich heraus, dass unser Ticket ein Schnipsel der Bedeutungslosigkeit war. Verträge werden hier geschlossen, um sie zu brechen. Leider war das unser abschließender Eindruck von Perú. Auf dem Terminal in Cusco geht es zu wie auf dem Markt und wir hatten eine halbe Stunde Zeit, unser Vertrauen einer anderen Busgesellschaft zu schenken. Inzwischen war es unwichtig, von wem wir uns übers Ohr hauen ließen. Mit schwachen Nerven und schwerem Gepäck stiegen wir in den Bus „Titicaca“, umklammerten unsere Rucksäcke und zockelten Richtung Puno. Von dort ging es im Trufi, einem Minibus, um den Titicacasee weiter nach Desaguadero, der Grenzstadt zu Bolivien. Wir tranken einen starken Instantkaffee, wechselten die restlichen Soles in Bolivianos und trotteten mit müden Augen über das Grenzbrückchen. Zwei Stempel (Ausreise Perú, Einreise Bolivien) später saßen wir im nächsten Trufi nach La Paz. Diese Stadt sollten wir fast ausschließlich aus der Vogelperspektive sehen. Für mehr als eine Fahrt in der Teleférico reichten unsere Kräfte nicht. Mit der Seilbahn lässt sich La Paz ganz entspannt umrunden. Man gleitet ruhig über das Verkehrschaos in den Straßen und lässt das Gewusel zwischen den Marktständen an sich vorüberziehen. Am Abend schlichen wir noch über den Hexenmarkt, wo Lama-Föten, Glücksbringer und allerlei Heilkräuter das Schicksal bestimmen. Ein Ananassaft und eine Dusche mit ordentlichem Wasserdruck ließen den aufregenden Tag ausklingen.


Ankunft in Bolivien
Am kommenden Morgen stiegen wir wieder in ein Flugzeug. Der ökologische Fußabdruck sollte sich mit diesem fünften Flug auf der Reise deutlich abzeichnen.
In Sucre empfingen uns die Sonne und Ekkehard. Er machte uns mit einigen hiesigen Gepflogenheiten vertraut und wies uns in die Arbeitsutensilien ein. Die mobile Einheit ist vollständig ausgerüstet und hatte während unseres gesamten Aufenthaltes problemlos funktioniert. Wir sortierten unsere Köfferchen nach Themen: Prophylaxe, Konservierend, Chirurgie und Endodontologie. Weiterhin hatten wir einen Heissluftsterilisator, einen klappbaren Behandlungsstuhl, ein separates Ultraschallgerät und eine separate Absauganlage, so dass wir parallel zu den Behandlungen Zahnreinigungen vornehmen konnten. Diese Ausstattung sollten wir in den nächsten Wochen an die entlegensten Orte transportieren und uns im Auf- und Abbau perfektionieren. Es ist faszinierend, überall behandeln zu können und nur eine Steckdose zu benötigen - denkt man an die vielen Auflagen, die es in Deutschland zu beachten gilt.
In Sucre empfingen uns die Sonne und Ekkehard. Er machte uns mit einigen hiesigen Gepflogenheiten vertraut und wies uns in die Arbeitsutensilien ein. Die mobile Einheit ist vollständig ausgerüstet und hatte während unseres gesamten Aufenthaltes problemlos funktioniert. Wir sortierten unsere Köfferchen nach Themen: Prophylaxe, Konservierend, Chirurgie und Endodontologie. Weiterhin hatten wir einen Heissluftsterilisator, einen klappbaren Behandlungsstuhl, ein separates Ultraschallgerät und eine separate Absauganlage, so dass wir parallel zu den Behandlungen Zahnreinigungen vornehmen konnten. Diese Ausstattung sollten wir in den nächsten Wochen an die entlegensten Orte transportieren und uns im Auf- und Abbau perfektionieren. Es ist faszinierend, überall behandeln zu können und nur eine Steckdose zu benötigen - denkt man an die vielen Auflagen, die es in Deutschland zu beachten gilt.
Zahnstatus in Bolivien
Wir waren froh, dass Ekkehard sich Zeit für uns genommen hatte, um die erste Woche gemeinsam an der Schule Gualberto Paredes zu arbeiten. Er zeigte uns seine Methoden der Fissurenversiegelung und Füllungstechnik, die ich gerne in meine zukünftige Arbeitsweise aufnehme. Für die gesamte Zeit in Bolivien sollten kleine Tapas (Füllungen) und Fissurenversiegelungen unsere Haupttätigkeit bleiben. Einige zerstörte Milchzähne und bleibende Molaren konnten wir extrahieren, das war jedoch die Ausnahme, weil dazu das Einverständnis der Eltern notwendig ist. Dazu hatten wir Zettel vorbereitet, welche die Kinder am Folgetag unterschrieben mitbringen sollten. Einige kamen wieder, doch wir merkten schnell, dass die meisten keinen Grund zur Extraktion sahen, sofern keine akuten Beschwerden vorlagen. Die Milchgebisse erwiesen sich als schockierend kariös, ganz besonders in Sucre. Ein kleiner Junge mit Lutscher im Mund und schelmischem Blick zeigte auf seinen Milchmolar und sagte „Necesito una tapa“ (Ich brauche eine Füllung) - ein Schlüsselerlebnis. Jedes Schulkind lutschte an einer Süßigkeit und hatte mindestens zwei kariös zerstörte Zähne. Neben den Milchmolaren waren leider auch häufig die ersten bleibenden Molaren betroffen. Oft kam hier jede Füllungstherapie zu spät. In der ländlichen Gegend sollte sich das etwas bessern, was nicht der Zahnpflege, sondern der etwas zuckerärmeren Ernährung geschuldet ist. Tatsächlich sehen die Bolivianer das Thema Karies schicksalsergeben, so wie die Mentalität in unseren Augen insgesamt fatalistisch ist. Mit großen, teils ängstlichen Augen blicken uns die Kinder an und fragten, ob wir einen Zahn ziehen. Ihre Sorge ist der Schmerz. Lückengebisse hingegen akzeptieren sie unbekümmert.
Insgesamt waren die Kinder erstaunlich zugänglich und ausdauernd während der Behandlungen. Oft ließ die kindliche Neugier alle anfänglichen Befürchtungen fallen. Bei diesen tiefen Kariesläsionen mussten wir natürlich häufig anästhesieren, doch durch gutes Zureden besänftigten wir schnell angstvolle Blicke auf Kanülen.
In Padilla beobachteten wir bei den Ärzten, dass sie sehr viel mit den Kindern kommunizieren und auch während der Behandlung geduldig und liebevoll mit ihnen sprechen.
Was uns erstaunte war die Therapie zerstörter Milchzähne. Selbst Abszesse und Fistelungen konnten die Ärzte nicht davon abbringen, den Zahn endodontisch zu versorgen sofern die Exfoliation noch nicht kurz bevorsteht.
Nicht selten sahen wir Hypoplasien an den bleibenden Zähnen, hervorgerufen durch unbehandelte und entzündete Milchzähne. Auch die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation sowie Zapfenzähne waren ein häufiges Bild.
Wir waren froh, dass Ekkehard sich Zeit für uns genommen hatte, um die erste Woche gemeinsam an der Schule Gualberto Paredes zu arbeiten. Er zeigte uns seine Methoden der Fissurenversiegelung und Füllungstechnik, die ich gerne in meine zukünftige Arbeitsweise aufnehme. Für die gesamte Zeit in Bolivien sollten kleine Tapas (Füllungen) und Fissurenversiegelungen unsere Haupttätigkeit bleiben. Einige zerstörte Milchzähne und bleibende Molaren konnten wir extrahieren, das war jedoch die Ausnahme, weil dazu das Einverständnis der Eltern notwendig ist. Dazu hatten wir Zettel vorbereitet, welche die Kinder am Folgetag unterschrieben mitbringen sollten. Einige kamen wieder, doch wir merkten schnell, dass die meisten keinen Grund zur Extraktion sahen, sofern keine akuten Beschwerden vorlagen. Die Milchgebisse erwiesen sich als schockierend kariös, ganz besonders in Sucre. Ein kleiner Junge mit Lutscher im Mund und schelmischem Blick zeigte auf seinen Milchmolar und sagte „Necesito una tapa“ (Ich brauche eine Füllung) - ein Schlüsselerlebnis. Jedes Schulkind lutschte an einer Süßigkeit und hatte mindestens zwei kariös zerstörte Zähne. Neben den Milchmolaren waren leider auch häufig die ersten bleibenden Molaren betroffen. Oft kam hier jede Füllungstherapie zu spät. In der ländlichen Gegend sollte sich das etwas bessern, was nicht der Zahnpflege, sondern der etwas zuckerärmeren Ernährung geschuldet ist. Tatsächlich sehen die Bolivianer das Thema Karies schicksalsergeben, so wie die Mentalität in unseren Augen insgesamt fatalistisch ist. Mit großen, teils ängstlichen Augen blicken uns die Kinder an und fragten, ob wir einen Zahn ziehen. Ihre Sorge ist der Schmerz. Lückengebisse hingegen akzeptieren sie unbekümmert.
Insgesamt waren die Kinder erstaunlich zugänglich und ausdauernd während der Behandlungen. Oft ließ die kindliche Neugier alle anfänglichen Befürchtungen fallen. Bei diesen tiefen Kariesläsionen mussten wir natürlich häufig anästhesieren, doch durch gutes Zureden besänftigten wir schnell angstvolle Blicke auf Kanülen.
In Padilla beobachteten wir bei den Ärzten, dass sie sehr viel mit den Kindern kommunizieren und auch während der Behandlung geduldig und liebevoll mit ihnen sprechen.
Was uns erstaunte war die Therapie zerstörter Milchzähne. Selbst Abszesse und Fistelungen konnten die Ärzte nicht davon abbringen, den Zahn endodontisch zu versorgen sofern die Exfoliation noch nicht kurz bevorsteht.
Nicht selten sahen wir Hypoplasien an den bleibenden Zähnen, hervorgerufen durch unbehandelte und entzündete Milchzähne. Auch die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation sowie Zapfenzähne waren ein häufiges Bild.


Am Abend spürten wir, was wir getan hatten, zumal es sich auf einem Schulhocker nicht besonders ergonomisch arbeiten ließ. Wir fielen wir nach einem Gläschen mit Ekkehard müde in unsere durchgelegenen Betten und schliefen stets tief und fest bis zum nächsten Morgen.
Sucre forderte jedoch schnell unser Nervengerüst: Wir schlängelten uns durch hupende Autokolonnen während mein Magen-Darm-Trakt gegen die mobilen Garküchen am Straßenrand rebellierte. An immer wieder Reis, Fleisch und Kartoffeln sollte ich mich bald gewöhnen, doch am zweiten Wochenende nutzte ich die Gelegenheit, aus der lauten Stadt herauszukommen.
Sucre forderte jedoch schnell unser Nervengerüst: Wir schlängelten uns durch hupende Autokolonnen während mein Magen-Darm-Trakt gegen die mobilen Garküchen am Straßenrand rebellierte. An immer wieder Reis, Fleisch und Kartoffeln sollte ich mich bald gewöhnen, doch am zweiten Wochenende nutzte ich die Gelegenheit, aus der lauten Stadt herauszukommen.
Potosí
Etwa drei Autostunden südwestlich von Sucre liegt Potosí. Der Ausflug dorthin beeindruckte mich so nachhaltig, dass ich ihn hier erwähnen möchte. Obwohl ich kaum etwas über den Ort wusste, zog er mich geradezu magisch an. Auf der Fahrt dorthin hielten wir an der Puente Méndez, eine alte Hängebrücke, die über den Río Pilcomayo führt und die Departements Chuquisaca und Potosí voneinander trennt. Der ehemalige Präsident Aniceto Arce war Leiter dieses Bauwerks, das als großartige Arbeit des Architektur- und Ingenieurwesens gilt. Die Brücke hängt an Stahlseilen, die an zwei Türmen im neogotischen Stil befestigt sind. Unter anderem diente die Brücke als Verbindungsstrecke zwischen Chile und La Paz, was für die bolivianische Wirtschaft wichtig war, da Potosí im Bergbau boomte. Heute kann man die Brücke nicht mehr befahren und sie hat nur noch touristische Funktion. Nach einer kurvenreichen Fahrt durch das zentrale Hochland mit schroffen Felsen und einsamen Ziegel-Dörfern erreichen wir Potosí. Die Konquistadoren mögen „El Dorado“ nie gefunden haben, dafür einen Silberberg, der eine kleine Andenstadt zur zweitgrößten Stadt der Welt werden ließ und das wirtschaftliche Vermögen von Westeuropa nach China beeinflusste. Im 17. Jahrhundert besetzten spanische Kolonialherren die Häuser, begierig darauf, den Berg auszubeuten. Aus dieser Zeit stammen die hübschen Kolonialhäuser. Außerdem beherbergt die Stadt nicht weniger als 37 barocke Kirchen. Die Kirchenportale sind hinreichend verziert im typischen Mestizo-Stil – Sonne und Mond stehen für Pachamama, die Mutter Erde, die sie mit der Jungfrau Maria zusammen als eine Person verehren; maskenartige Gesichter sollen vielleicht indigene Gottheiten darstellen. Wir sahen uns die alte Münze an. Es ist paradox: Hier, wo einst sozusagen der Kapitalismus entstand, herrscht heute erschütternde Armut.
Nach 60.000 Tonnen Silberausbeute über drei Jahrhunderte ist der Berg ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse und überschattet die Stadt in gewaltiger Kargheit. Heruntergewirtschaftet hält er kaum noch Silberschätze bereit und dennoch arbeiten hier Tausende und versuchen dem Berg Zinn, Zink und Erz abzutrotzen. Die Kinderarbeit ist ab zwölf Jahren erlaubt, aber die meisten gehen schon viel früher in den „Berg, der Menschen frisst“, wie die indigene Bevölkerung hier ihren Cerro Rico, den „reichen Berg“, nennt. Die Armut treibt sie in die Minen. Staub, giftige Gase und Luft- und Temperaturunterschied zwischen den Tiefen der Minen und der Oberfläche führen zu Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Bis zu zwanzig Menschenleben fordert der Berg jeden Monat, die meisten sind unter 30 Jahre alt.
Nach 60.000 Tonnen Silberausbeute über drei Jahrhunderte ist der Berg ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse und überschattet die Stadt in gewaltiger Kargheit. Heruntergewirtschaftet hält er kaum noch Silberschätze bereit und dennoch arbeiten hier Tausende und versuchen dem Berg Zinn, Zink und Erz abzutrotzen. Die Kinderarbeit ist ab zwölf Jahren erlaubt, aber die meisten gehen schon viel früher in den „Berg, der Menschen frisst“, wie die indigene Bevölkerung hier ihren Cerro Rico, den „reichen Berg“, nennt. Die Armut treibt sie in die Minen. Staub, giftige Gase und Luft- und Temperaturunterschied zwischen den Tiefen der Minen und der Oberfläche führen zu Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Bis zu zwanzig Menschenleben fordert der Berg jeden Monat, die meisten sind unter 30 Jahre alt.
Zufällig feierte an diesem Tag eine Kooperative ihr 125jähriges Bestehen. Wir liefen am Fuß des Berges durch den Staub, ergriffen von dem bedrückenden Bild der Mineneingänge mit kleinen Hütten davor. Aus Neugier beschloss ich hinzugehen. Eine Band spielte Musik, die in meinen Ohren schwermütig klang, doch der Sänger stellte die Gruppe vor als „la banda con la música más alegre del mundo“ (die Band mit der fröhlichsten Musik der Welt). Der Leiter der Kooperative bot uns sichtlich angetrunken Potosina-Bier aus Plastikbechern an. Sie seien stolz, dass wir ihre Gäste sind und wollten mit uns tanzen. Doch wir spürten, dass wir nicht bleiben sollten. Die Gesichter und der ganze Schrecken dieses Ortes blieben in meinem Kopf.
Aus jeder Gasse und von jedem Platz war der Berg sichtbar und als ich abends in einem Hostel der Stadt unter warmen Wolldecken lag, dachte ich an die Jungen, die nun in die Minen kriechen. Die meisten sind so jung, dass sie tagsüber zur Schule gehen und nachts arbeiten müssen. Ihr Proviant besteht aus Zigaretten, Kokablättern und Dynamit.
Auf der Rückfahrt nach Sucre fiel mir am Ortsausgang ein Werbeplakat von Cristian Apaza ins Auge. Der Unternehmer leitet das Projekt „Yo Pro“, das Schülern den Arbeitsmarkt vorstellen und eine berufliche Orientierung geben möchte. Neben dem Slogan stand „Vale un Potosí“, was im spanischen Sprachgebrauch noch immer bedeutet, dass etwas unbezahlbar ist. Diese Redewendung als gewinnender Werbespruch machte mich nachdenklich.
Aus jeder Gasse und von jedem Platz war der Berg sichtbar und als ich abends in einem Hostel der Stadt unter warmen Wolldecken lag, dachte ich an die Jungen, die nun in die Minen kriechen. Die meisten sind so jung, dass sie tagsüber zur Schule gehen und nachts arbeiten müssen. Ihr Proviant besteht aus Zigaretten, Kokablättern und Dynamit.
Auf der Rückfahrt nach Sucre fiel mir am Ortsausgang ein Werbeplakat von Cristian Apaza ins Auge. Der Unternehmer leitet das Projekt „Yo Pro“, das Schülern den Arbeitsmarkt vorstellen und eine berufliche Orientierung geben möchte. Neben dem Slogan stand „Vale un Potosí“, was im spanischen Sprachgebrauch noch immer bedeutet, dass etwas unbezahlbar ist. Diese Redewendung als gewinnender Werbespruch machte mich nachdenklich.


Padilla
Am darauffolgenden Tag nahmen wir die Reise wieder auf und fuhren nach Padilla. Das sollte für die restliche Zeit unser ländliches Domizil sein.
In der flota (Reisebus) verstauten wir in sechzehn Gepäckstücken unsere Praxis und unsere eigenen Habseligkeiten. Über vier Stunden dauerte die Fahrt durch Tarabuco, Zudañez und Tomina bevor wir gegen 23 Uhr in Padilla ankamen.
Unser Zimmer befand sich oberhalb der Markthalle und wir waren begeistert. Es war geräumig mit eigenem Bad und kleinem Balkon, von dem wir allmorgendlich den gemächlichen Marktaufbau auf dem Platz beobachteten. Schnell hatten wir es uns häuslich eingerichtet. Ein Wasserkocher, Kerzen, Kaffee und Tee sollten künftig unsere täglichen Abend- und Nachtrituale ermöglichen. Schon bald kannten wir den Inhaber des Supermercados, die Obst- und Gemüsefrauen, den Restaurantinhaber der Pension, die Brotfrauen und Popcornverkäuferinnen, die wenigen Taxifahrer im Ort, einen freundlichen Gaucho mit Pferd, auf dem wir reiten durften, Dr. Ramiro und seinem leckeren Maisschnaps „Chicha charque“ und natürlich die Kliniks(zahn)ärzte. Ach was, eigentlich noch viele mehr, die Kinder nicht zu vergessen, die uns mit erstaunten dunklen Augen anblickten, schüchtern lächelten und uns mit „las doctoras“ begrüßten.
Die Zeit dort war ruhig, beschaulich und dennoch reich an Erfahrungen.
Das Besondere waren die Menschen, die uns interessiert und herzlich aufnahmen. Hemmungen, vorsichtige Zurückhaltung oder Gegenleistungen irritierten dort nur. Dra. Sonia Rodríguez lächelte uns verständnislos an, als wir unsere gewaschene Wäsche bezahlen wollten – stattdessen lud sie uns zum Kochen ein. Dr. Ramiro malte ein Herz auf seine Brust als wir uns für den Ausritt auf seinen Pferden bedankten. Einladungen, so lernten wir, sind zum Genießen da und nicht, um über den Dank zu grübeln. Wir nahmen es an.
Odonto-movil
In der flota (Reisebus) verstauten wir in sechzehn Gepäckstücken unsere Praxis und unsere eigenen Habseligkeiten. Über vier Stunden dauerte die Fahrt durch Tarabuco, Zudañez und Tomina bevor wir gegen 23 Uhr in Padilla ankamen.
Unser Zimmer befand sich oberhalb der Markthalle und wir waren begeistert. Es war geräumig mit eigenem Bad und kleinem Balkon, von dem wir allmorgendlich den gemächlichen Marktaufbau auf dem Platz beobachteten. Schnell hatten wir es uns häuslich eingerichtet. Ein Wasserkocher, Kerzen, Kaffee und Tee sollten künftig unsere täglichen Abend- und Nachtrituale ermöglichen. Schon bald kannten wir den Inhaber des Supermercados, die Obst- und Gemüsefrauen, den Restaurantinhaber der Pension, die Brotfrauen und Popcornverkäuferinnen, die wenigen Taxifahrer im Ort, einen freundlichen Gaucho mit Pferd, auf dem wir reiten durften, Dr. Ramiro und seinem leckeren Maisschnaps „Chicha charque“ und natürlich die Kliniks(zahn)ärzte. Ach was, eigentlich noch viele mehr, die Kinder nicht zu vergessen, die uns mit erstaunten dunklen Augen anblickten, schüchtern lächelten und uns mit „las doctoras“ begrüßten.
Die Zeit dort war ruhig, beschaulich und dennoch reich an Erfahrungen.
Das Besondere waren die Menschen, die uns interessiert und herzlich aufnahmen. Hemmungen, vorsichtige Zurückhaltung oder Gegenleistungen irritierten dort nur. Dra. Sonia Rodríguez lächelte uns verständnislos an, als wir unsere gewaschene Wäsche bezahlen wollten – stattdessen lud sie uns zum Kochen ein. Dr. Ramiro malte ein Herz auf seine Brust als wir uns für den Ausritt auf seinen Pferden bedankten. Einladungen, so lernten wir, sind zum Genießen da und nicht, um über den Dank zu grübeln. Wir nahmen es an.
Odonto-movil
Die erste Woche in Padilla arbeiteten wir im Odonto-movil – ein Mercedes-Bus, der von der Regierung für jede Gemeinde bereitgestellt wird. Ist das Gefährt nicht unterwegs, um Schulen anzusteuern, nutzen die Zahnärzte in Padilla den Bus als zusätzliches Behandlungszimmer.
Leider versagte der Motor als wir in der zweiten Woche eine ferner gelegene Schule in den Bergen ansteuern wollten. Seither waren wir mit der „Ambulancia“ unterwegs und arbeiteten nun wieder mit unserer mobilen Praxis.
Leider versagte der Motor als wir in der zweiten Woche eine ferner gelegene Schule in den Bergen ansteuern wollten. Seither waren wir mit der „Ambulancia“ unterwegs und arbeiteten nun wieder mit unserer mobilen Praxis.
Von Padilla aus unternahmen wir nur zwei kleine Sonntagsausflüge. Serrano war unser erstes Ziel. In einem überfüllten Trufi holperten wir über unbefestigte Feldwege und kleine Flüsse durch die grüne Berglandschaft. Mit im Geleit waren Gauchos und Marktfrauen, die mit ihren langen Zöpfen gleichmütig unter den Sombreros blinzelten und ihre müden Kinder auf dem Schoß hielten. Die meisten waren frühmorgens in Padilla auf dem Markt gewesen. Ab und an stieg jemand aus und lief gemächlich ins Nirgendwo. Serrano ist ein noch kleinerer Ort als Padilla. Hier kauften wir stolz unsere Sombreros – schwarze Filzhüte unter denen wir uns den Indígenas noch näher fühlten.
Der zweite Ausflug führte uns nach Tarabuco. Dieses Dorf ist berühmt für seinen großen kunterbunten Markt, der den gesamten Ort durchzieht und alles Erdenkliche für wenige Bolivianos bereithält.
Tabacal
Nachdem wir in den ersten beiden Wochen vor allem in Padilla und im nahen Umland gearbeitet hatten, sollten wir in der dritten Woche in das entlegene Tabacal fahren. Es hatte die ganze Nacht geregnet und der lehmige Weg dorthin führt steil durch die Berge. Aufgeweichter Boden, Felsbrocken, umgekippte Bäume und Sträucher machten die Fahrt für uns zu einem erschreckend-begeisterten Erlebnis. Tatsächlich waren wir in einer Dschungel-Landschaft angekommen, durchzogen von einem Fluss, der in Serrano entspringt und durch den Regen wie eine Flut Cappuccino aussah. In Tabacal begrüßte uns der sympathische Zahnarzt Dr. Mayer Ayllon Rodas. Nachdem wir im Nu unsere Praxis eingerichtet hatten, darin waren wir inzwischen routiniert, zeigte er uns die atemberaubende Umgebung. Außer der Klinik, einer Schule mit Internat und einer Tienda gibt es nur den Fluss und den Urwald, der sich links und rechts die Berge hochzieht. Wie waren begeistert. Unten am Flussbett wachsen Zuckerrohr, Mais, Bananen, Papayas und Orangen.
Behandlung
Die Kinder nahmen auch hier bereitwillig unsere Behandlungen an. Manchmal kullerte ein Tränchen, was sie aber nicht daran hinderte, den Mund weiterhin geöffnet zu halten und uns mit großen Augen anzusehen. Hier wäre ich gerne Kinderzahnärztin.
Wir blieben drei wunderbare Tage.
Der Abschied fiel uns schwer. Wir waren viel unterwegs gewesen und jeden Tag hieß es, sich von den Kindern, Lehrern und Köchinnen zu verabschieden. Hier fiel es mir jedoch umso schwerer, weil es unser letzter Behandlungstag war. Wir wussten, dass wir alles zum letzten Mal zusammenpackten. Auf der Rückfahrt liefen viele traurige Lieder, die von Abschied handelten und obwohl die Straße nicht weniger abenteuerlich war, fuhren wir recht unaufgeregt immer weiter in die Nebelwolken hinein zurück Richtung Padilla, wo wir unsere letzte Nacht feiern würden.
Der Abschied fiel uns schwer. Wir waren viel unterwegs gewesen und jeden Tag hieß es, sich von den Kindern, Lehrern und Köchinnen zu verabschieden. Hier fiel es mir jedoch umso schwerer, weil es unser letzter Behandlungstag war. Wir wussten, dass wir alles zum letzten Mal zusammenpackten. Auf der Rückfahrt liefen viele traurige Lieder, die von Abschied handelten und obwohl die Straße nicht weniger abenteuerlich war, fuhren wir recht unaufgeregt immer weiter in die Nebelwolken hinein zurück Richtung Padilla, wo wir unsere letzte Nacht feiern würden.
Abschied
Es war ein Straßenfest, so wie die meisten Feste hier. Die Ärzte von Padilla zeigten uns, wie man trinkt und tanzt. Ein Abschied, der fröhlich war, wobei mir die Musik und ihre Texte doch wieder etwas melancholisch vorkamen – möglicherweise ist das Verständnis von traurig und fröhlich dort ein anderes.
Unsere Abreise in Santa Cruz würde nun den Rahmen sprengen. Nur so viel sei gesagt: Alles, was ich mir auf der Reise über Bolivien zusammen gepuzzelt hatte, musste ich in Santa Cruz über Bord werfen. Im Oriente ist das Leben so ganz anders. Nicht europäisch, aber doch gesättigter und weniger ursprünglich. Schließlich empfand ich doch noch so etwas wie einen Kulturschock.
Unsere Abreise in Santa Cruz würde nun den Rahmen sprengen. Nur so viel sei gesagt: Alles, was ich mir auf der Reise über Bolivien zusammen gepuzzelt hatte, musste ich in Santa Cruz über Bord werfen. Im Oriente ist das Leben so ganz anders. Nicht europäisch, aber doch gesättigter und weniger ursprünglich. Schließlich empfand ich doch noch so etwas wie einen Kulturschock.
Muchas gracias!
Zu guter Letzt möchte ich mich bedanken für dieses tief berührende Erlebnis: bei Janina, die mit mir durch Flora und Fauna, Hochs und Tiefs gegangen ist; bei den bolivianischen Zahnärzten und Kindern, die ich wunderbar finde; und natürlich bei Ekkehard und dem FCSM, die diese Famulatur möglich machten. Es war ganz bestimmt nicht meine letzte Reise in dieses Land!
Judith Hosbach